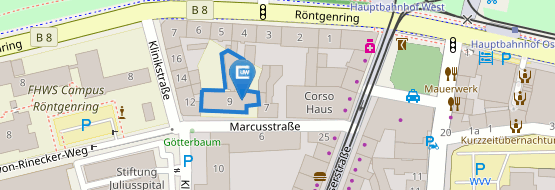Frühere Forschungsprojekte
Die Universitätsambulanz unterstützt seit ihrer Gründung psychotherapienahe Forschungsprojekte am Lehrstuhl für Psychologie I und führt Therapiestudien durch. Hier finden Sie eine Übersicht der vielfältigen Forschungsaktivitäten an der Universitätsambulanz in den vergangenen Jahren.
Expositionstherapie bei Angststörungen
Ein Forschungsschwerpunkt der Universitätsambulanz liegt seit langem auf der Behandlung von Angststörungen mit Expositionstherapie. In verschiedenen, teils großen und multizentrischen Therapiestudien wurde die Wirksamkeit der Expositionstherapie bei spezifischen Phobien, Agoraphobie, Panikstörung und sozialer Phobie untersucht. Zudem wurden im Rahmen der Therapiestudien Wirkmechanismen der Expositionstherapie beforscht.
EVElyn
Das BMBF-geförderte Projekt „EVElyn“ ist ein Verbund aus Klinischen Psychologen, Experten der Mensch-Computer-Interaktion und dem VR-Unternehmen VTplus. Das Projekt zielt darauf ab, in Abstimmung mit prospektiven Nutzern (Patienten, Psychotherapeuten) ein auf die Erfordernisse der Praxis zugeschnittenes Virtual Reality-Therapiesystem zu entwickeln.
Die Hochschulambulanz war als eines von mehreren Therapiezentren von 2019 bis 2023 in dieses Projekt eingebunden. Im Rahmen der Therapiestudie „Expositionstherapie in VR: Prozessanalyse“ sollte der Einsatz der Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) im Vergleich zu anderen Formen der Expositionstherapie und insbesondete das Potential für eine Effizienzsteigerung in der psychotherapeutischen Versorgung von Angststörungen durch den Einsatz neuester Technilen untersucht werden.
ELAN (2020 - 2022)
Zur Behandlung von Angststörungen wird oft eine Expositionstherapie eingesetzt – eine spezifische Form der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT). Die Wirksamkeit dieser Therapieform wurde in vielen Studien nachgewiesen und es konnte mit dieser Therapie bereits vielen Betroffenen geholfen werden. Leider wissen wir noch nicht genug über die genaue Wirkweise dieser Behandlungsform, z.B. welche Therapieinhalte bei welchen Patienten/innen besonders wichtig sind.
Ziel der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Therapiestudie ELAN war es, die Wirkmechanismen der Expositionstherapie besser zu verstehen und dadurch die Wirksamkeit der Psychotherapie bei Angststörungen zu verbessern. Dabei waren wir insbesondere daran interessiert, wie und wann angstauslösende Situationen vermieden oder aufgesucht werden.
Alle Teilnehmer/innen erhielten eine hochwirksame Expositionstherapie, die von speziell für Angststörungen geschulten Therapeuten/innen durchgeführt wurde. Diese etablierte Kurzzeittherapie wurde begleitet durch diagnostische Fragebögen, wissenschaftliche Zusatzuntersuchungen und eine alltagsnahe Befragung mittels Smartphone. Dies erlaubte uns, herauszufinden, welche Faktoren mit besonders gutem Therapieerfolg zusammenhängen und warum die von uns angebotene Psychotherapie so gut helfen kann.
Erste in der internationalen Fachzeitschrift „Depression and Anxiety“ veröffentlichte Studienergebnisse lieferten zudem wichtige Einblicke in die Mechanismen pathologischer Vermeidung bei Angststörungen. So weisen die Ergebnisse darauf hin, dass positive Anreize für Annäherung bei Angststörungen weniger stark berücksichtigt werden. Ein verstärkter Behandlungsfokus auf diese positiven Aspekte könnte entsprechend zur Reduktion von Vermeidung und somit letztlich zur Verbesserung expositionsbasierter Therapien beitragen. Weitere Publikationen sind aktuell in Vorbereitung.
Pressespiegel:
Arte, 02/2019: Wenn Angst krank macht – Anatomie eines Gefühls (Dokumentation)
Protect-AD (2015 - 2019)
5% aller Bundesbürger leiden unter einer Angsterkrankung wie die Panikstörung, Agoraphobie (Platzangst), Phobien oder die sogenannte Generalisierte Angststörung, die typischerweise gar nicht bzw. erst nach vielen Jahren erkannt werden. Aber selbst wenn die Erkrankung richtig diagnostiziert wird, erhält die überwiegende Zahl betroffener Patienten keine geeignete Therapie, so dass diese oft zusätzliche Erkrankungen wie Depression oder eine Suchterkrankung entwickeln und in ihrer weiteren persönlichen Entwicklung beeinträchtigt bleiben.
Das Forschungsprogramm PROTECT-AD, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hatte zum Ziel, die kognitive Verhaltenstherapie als wirksamste und wissenschaftlich am besten bewährte Therapieformweiter zu verbessern und so zu verändern, dass sie für alle Betroffenen zugänglich und langfristig wirksam wird. Kern des Forschungsverbundes waren Studien, die sich mit den Extinktonslernen befassten, was als zentraler Wirkmechanismus der Angsttherapie gilt. Durch den Einsatz moderner Untersuchungsverfahren sollte erforscht werden, wie sich unser Denken, Fühlen und Handeln sowie biologischen Vorgänge in unserem Körper während der Therapie verändern. Wenn die Wirkmeschanismen einer erfolgreichen Angsttherapie genauer verstanden werden, kann sich auch die Versorgungssituation verbessern.
Die Hochschulambulanz an der Universität Würzburg war eines von sieben bundesweiten Therapiezentren, in denen eine optimierte (intensivierte) psychotherapeutische Intervention für die Behandlung von Angststörungen durchgeführt und evaluiert wurde.
Paniknetz (2007 - 2012)
Ein umfangreiches Forschungsvorhaben zur Psychotherapie von Panikstörungen (Paniknetz) konnte aufgrund einer Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) realisiert werden, in dem sieben hochqualifizierte, universitäre psychotherapeutische Zentren bundesweit weit zusammenarbeiteten. Darüber hinaus wurden im Zusammenschluss weiterer Forschungsgruppen biologische Mechanismen der Panikstörung untersucht, wie z.B. die körperlichen Reaktionen bei Panikanfällen, die Aktivierung bestimmter Regelkreise im Gehirn, die genetischen Grundlagen der Erkrankung als auch ihre therapeutische Beeinflussung durch Medikamente.
Die Hochschulambulanz an der Universität Würzburg war eines der sieben Therapiezentren, in dem die kognitive Verhaltenstherapie spezifisch hinsichtlich ihrer einzelnen Wirkkomponenten untersucht werden sollte. Ziel ist es dabei zu erfassen, inwieweit das bestehende Therapiekonzept optimiert und modifiziert werden kann (Exposition durch Therapeuten begleitet oder Exposition alleine). Darüber hinaus sollen mögliche zusätzliche Ergolgskriterien evaluiert werden (antizipatorisches sowie auf mögliche spezielle Bedürfnisse bei Patienten mit komorbiden Erkrankungen, persönlichkeitsvariablen und speziellen biographischen Gegebenheiten fokussiert werden.
Die langfristige Effektivität von kognitiver Verhaltenstherapie bei Panikstörung mit und ohne Agoraphobie ist durch Studien eindrucksvoll belegt. Unklar war, in welchem Format und Umfang die verschiedenen Wirkkomponenten ihre beste Wirkung entfalten. Hauptfrage war daher, ob sich Unterschiede zwischen den aktiven Bedingungen finden lassen, die eine der beiden Bedingungen als geeigneter für die Behandlung einer Panikstörung mit und ohne Panikstörung erscheinen lassen.
Pressespiegel:
Kitzinger Zeitung, 22.08.2012: "Endlich keine Angst mehr haben müssen (pdf)"
Mainpost 28.05.2011: "Wenn Angst ans Herz greift (pdf)"
Mainpost 28.10.2007: "Die lähmende Angst vor der Angst (pdf)"
Digitale Anwendungen in der Psychotherapie
Klassische Psychotherapien werden können zunehmend durch digitale Angebote, sogenannte Digitale Gesundheitsanwendungen, unterstützt und ergänzt werden. Die Universitätsambulanz unterstützt Forschungsbemühungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen unter Einbezug digitaler Angebote.
ELONA (2022-2023)
Wie verbessert die Digitalisierung die psychotherapeutische Behandlung? Die verzahnte kognitive Verhaltenstherapie (auch blended CBT oder bCBT genannt) kombiniert die persönliche Therapie mit digitalen Elementen wie Gesundheits-Apps. Viele Forscher und Praktiker gehen davon aus, dass bCBT potenzielle Vorteile bei der Behandlung psychischer Störungen wie Depressionen hat. Studien, die bCBT mit kognitiver Verhaltenstherapie (CBT) vergleichen, sind jedoch aktuell noch begrenzt und haben gemischte Ergebnisse hervorbracht.
Ziel dieser Studie ist die Evaluierung der digitalen Gesundheitsanwendung elona therapy (www.elona.health). Diese Anwendung behebt die Unzulänglichkeiten bisheriger bCBT-Ansätze, indem sie personalisierte digitale Interventionen anbietet, die mit dem Inhalt der einzelnen persönlichen Therapiesitzungen verzahnt sind. Auf diese Weise bewahrt die Anwendung die Autonomie von Therapeuten und Patienten. elona therapy besteht aus einer Patienten (Smartphone-Anwendung) und einer Therapeut:en-Anwendung (Web-Anwendung). In verzahnten Psychotherapie mit elona therapy können Psychotherapeuten routinemäßig digitale therapeutische Inhalte und psychoedukative Ressourcen anpassen, die auf der Grundlage der aktuellen Symptomatik der Patienten, ihrer persönlichen Merkmale sowie des psychotherapeutischen Schwerpunkts und Fortschritts personalisiert werden. Die Inhalte der elona-Therapie, aus denen Psychotherapeuten wählen können, basieren auf aktuellen und wissenschaftlich fundierten Leitlinien und Behandlungsmanualen.
Verkehrsunfälle und Fahrangst
Verkehrsunfälle sind häufig und einige Menschen entwicklen in der Folge psychische Belastungen oder eine anhaltende Angst vor dem Autofahren. Die Universitätsambulanz beteiligte sich an zwei Kooperationsprojekten, in das Auftreten psychischer Belastungen, Fahrangst und Fahrverhalten bei verunfallten Personen untersucht wurden.
Unfallfolgen (2020-2022)
Nach Verkehrsunfällen können neben körperlichen Verletzungen auch psychische Unfallfolgen wie Fahrangst, Posttraumatische Belastungsstörung oder Depression auftreten. Ziel des von der Bundesanstalt für Straßenwesem (BASt) geförderten Projekts war es, die selbstständige und sichere Mobilität von mit dem Auto, Motorrad oder LKW verunfallten Personen zu fördern und dabei psychische Unfallfolgen zu berücksichtigen.
Zusammen mit dem Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW) untersuchten wir, wie solche psychischen Unfallfolgen sich auf das Fahrverhalten und die Fahrkompetenz auswirken. Dazu erfassten wir bei verunfallten Autofahrern und zum Vergleich bei Fahrern ohne Unfall die psychische Belastung und führen in Zusammenarbeit mit einer Würzburger Fahrschule Fahrverhaltensbeobachtungen in realen Verkehrssituationen durch. Im Rahmen des Projektes untersuchten wir außerdem, ob es für psychische Unfallfolgen Risikogruppen gibt, und welche Therapieformen verunfallte Personen mit psychischen Belastungen nutzen.
Die im Projektbericht "Psychische Unfallfolgen" veröffentlichten Studienergebnisse wiesen auf eine erhöhte psychische Belastung in der Gruppe der verunfallten Personen hin. In Bezug auf die verkehrssicherheitsrelevante Fahrkompetenz gab es allerdings keine Hinweise auf Unterschiede zwischen den verunfallten und den nicht verunfallten Personen. Allgemeine Programme zur Förderung des Fahrverhaltens verunfallter Personen erscheinen damit zunächst nicht notwendig. Nach Verkehrsunfällen sollte aber die psychische Belastung der Verunfallten erfasst und bei anhaltender Belastung eine adäquate Therapie angeboten werden.
Fahrangst (2016 - 2017)
Nach einem Verkehrsunfall leiden viele Betroffene an psychischen Störungen, die mit andauernder Fahrangst und Fahrvermeidung einhergehen können. Die Expositionstherapie gilt als Methode der Wahl zur Behandlung von Angststörungen, wobei zunehmend auch virtuelle Verfahren eingesetzt werden. Die Behandlung von Fahrangst in der virtuellen Realität wurde jedoch lange Zeit kaum untersucht.
Von April 2016 bis Juni 2017 wurde daher eine innovative Pilotstudie in Kooperation zwischen dem Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW) und der Hochschulambulanz für Psychotherapie unter Förderung derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) durchgeführt (Genehmigung durch die Ethik-Kommission der Bayerischen Landesärztekammer am 5. Oktober 2015). Ihr Ziel war es, eine Expositionstherapie in der Fahrsimulation zur Behandlung von Fahrangst nach Verkehrsunfällen zu entwickeln und zu evaluieren.
Die Therapie wurde nach einem eigens entwickelten, standardisierten Therapiemanual durchgeführt und umfasste insgesamt 13 Sitzungen, die fünf virtuelle Expositionssitzungen im Fahrsimulator, vor- und nachbereitende psychotherapeutische Gespräche, eine abschließende Fahrprobe mit Fahrlehrer sowie zwei telefonische Booster- bzw. Follow-up-Sitzungen nach 6 bzw. 12 Wochen umfassten.
Die virtuellen Expositionssitzungen fanden in einem High-Fidelity-Simulator mit voll ausgestattetem Mockup (Opel Insignia) statt. Die Expositionsszenarien wurden spezifisch an die individuelle Angsthierarchie der Patienten angepasst. Insgesamt wurden 14 Patienten, die einer Warte- und einer Behandlungsgruppe zugeteilt wurden, behandelt. Sechs davon vermieden das Autofahren grundsätzlich (sog. Vollvermeider), die übrigen acht vermieden bestimmte Strecken oder Fahraufgaben (wie Autobahn oder größere Innenstädte). Die Wirkung der Behandlung wurde anhand verschiedener Maße (Verhaltenskriterien, Einschätzungen der Patieten, physiologische Variablen beurteilt. Die Ergebnisse belegen einen hervorragenden Erfolg der Behandlung.
- Alle 14 Patienten absolvierten in einer abschließenden Fahrprobe mit Fahrlehrer im realen Straßenverkehr Aufgaben, die sie vorab vermieden hatten.
- 71% davon zeigten hierbei auch ein laut Fahrlehrer angemessenes Fahrverhalten.
- 79% empfanden dabei weniger Angst als sie vor der Behandlung antizipiert hatten.
- 93% konnten den Erfolg bis zum Follow-up nach 12 Wochen aufrechterhalten.
- 57% der Patienten zeigten gemäß ihren Angaben im Follow-up gar kein Vermeidungsverhalten mehr. Insgesamt wurden 74% aller ursprünglich vermiedenen Fahrsituationen wieder bewältigt.
Innerhalb der Wartegruppe, welche die Behandlung nach einer Woche Verzögerung erhielt, zeigten sich keine bedeutsamen Veränderungen im Verlauf der Wartephase. Die Mehrheit der Patienten war von ihrem Erfolg überwältigt, bewertete die Behandlung in der abschließenden Evaluation als positiv (Gesamtnote 1,63) und stimmte der Frage, ob die Behandlung der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, eindeutig zu.
Die Fahrsimulation erwies sich vor allem aufgrund der Möglichkeit zur gezielten Herstellung angstauslösender Verkehrssituationen als äußerst vielversprechendes therapeutisches Medium. In nachfolgenden Studien gilt es, die Behandlung mit einer aktiven Kontrollbedingung zu vergleichen. Darüber hinaus sollten kleinere Ausbaustufen von Simulatoren untersucht werden, um eine großflächige Versorgung Betroffener zu ermöglichen.on der Bayerischen Landesärztekammer genehmigt.


Referenzen:
- Kaussner, Y., Hoffmann, S. & Schoch, S., Markel, P., Baur, R. & Pauli, P. (2017). Entwicklung und Evaluation einer Expositionstherapie in der Fahrsimulation zur Behandlung von Fahrangst nach Verkehrsunfällen - Eine Pilotstudie gefördert von der DGUV. Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2, 100-101.
- Kenntner-Mabiala, R., Kaussner, Y., Baur, R., Schoch, S., Hoffmann, S., Markel, P., Kuraszkiewicz, A. & Pauli, P. (2017). Treatment of patients with fear of driving following a traffic accident by a virtual reality exposure therapy in a driving simulator - a pilot study funded by the DGUV (FR232). Oral Presentation at the WPA XVII World Congress of Psychiatry, Berlin, 9-12 October 2017
- Kuraszkiewicz, A., Kaussner, Y., Baur, R., Schoch, S., Hoffmann, S., Markel, P. & Pauli, P. (2017). Entwicklung und Evaluation einer Expositionstherapie in der Fahrsimulation zur Behandlung von Patienten mit Fahrangst nach Verkehrsunfällen. Vortrag auf der 32. Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropsychologie, Konstanz, 21.-23.9.2017.
- Kaussner, Y., Markel, P., Baur, R., Schoch, S., Ebert, S. & Pauli, P. (2016). Entwicklung und Evaluation einer Expositionstherapie in der Fahrsimulation zur Behandlung von Patienten mit Fahrangst nach Verkehrsunfällen. Blutalkohol 53: Sup III - 24.
- Kaussner, Y., Markel, P., Baur, R., Hoffmann, S., Schoch, S. & Pauli, P. (2016). Entwicklung und Evaluation einer Expositionstherapie in der Fahrsimulation zur Behandlung von Patienten mit Fahrangst nach Verkehrsunfällen - Eine Pilotstudie. Posterpräsentation beim 12. Gemeinsamen Symposium der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM) und der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP), Rostock, 30.09. - 01.10.2016.