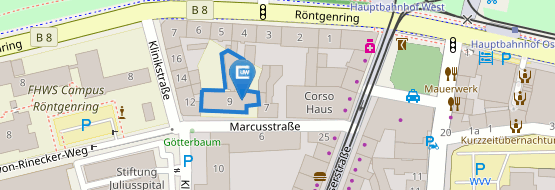Aktuelle Projekte
Auswertung von Routine-Daten
Im gesamten Verlauf einer Psychotherapie fallen Daten zum Therapiegeschehen und dem Therapiefortschritt an, welche für die Psychotherapie-Forschung von großer Bedeutung sind. Dabei handelt es sich beispielsweise um Angaben zum Alter und Geschlecht und um die Daten aus standardisierten Diagnostikinstrumenten, wie beispielsweise Fragebögen.
Auf Basis der freiwilligen Einwilligung der Patientinnen und Patienten sammelt die Universitätsambulanz diese Routine-Daten in pseudonymisierter Form in einer Forschungsdatenbank. Personenidentifizierende Daten wie Name, Adresse oder Geburtsdatum werden nicht in der Forschungsdatenbank gespeichert. Patientinnen und Patienten, die ihre Daten nicht für die Forschung freigeben wollen, können selbstverständlich trotzdem an der Universitätsambulanz behandelt werden.
Mit den in der Forschungsdatenbank gespeicherten Routine-Daten kann erforscht werden, welche Faktoren bereits zu Therapiebeginn einen günstigeren oder weniger günstigen Therapieverlauf erwarten lassen und wie sich die Prognose für bestimmte Gruppen von Patientinnen und Patienten verbessern lässt. Perspektivisch können so die Therapien besser personalisiert und die Therapieergebnisse gerade für Patientinnen und Patientin mit einem erhöhten Risiko für ungünste Therapieverläufe verbessert werde.
Aktuell erforschen wir beispielsweise, wie zwischenmenschliche Erfahrungen in der Kindheit mit der Qualität der therapeutischen Beziehung während der Therapie und dem Therapieerfolg in Zusammenhang steht.
Ansprechpartnerin: Franziska Epe-Jungeblodt, franziska.epe@uni-wuerzburg.de
Die Rolle traumatischer Lebensereignisse für Psychotherapieverläufe
Als Traumata werden außergewöhnlich bedrohliche oder katastrophale Ereignisse bezeichnet, beispielsweise schwere Unfälle, aber auch verschiedene Formen von Gewalterfahrungen oder Übergriffen. Zudem zählen Erfahrungen von Misshandlung oder Vernachlässigung während der Kindheit zu traumatischen Erlebnissen. Wie stehen solche Erlebnisse mit dem Verlauf und der Wirksamkeit einer Psychotherapie, teils Jahre später, in Verbindung? Von welchen therapeutischen Interventionen profitieren Patientinnen und Patienten, die Traumata erlebt haben, möglicherweise besonders?
Dies wird an der Universitätsambulanz anhand der anonymisierten Therapiedaten von Patientinnen und Patienten, die an der Universitätsambulanz in Therapie sind oder waren, untersucht. Ein besseres Verständnis der möglichen Auswirkungen von traumatischen Ereignissen in der Biographie auf den Verlauf einer Psychotherapie soll dazu beitragen, traumatische Erfahrungen in der Psychotherapie besser zu berücksichtigen, den Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten mit traumatischen Erfahrungen besser zu entsprechen und die Wirksamkeit der Therapien zu verbessern.
Ansprechpartnerin: Franziska Epe-Jungeblodt, franziska.epe@uni-wuerzburg.de
Publikationen:
Routine Outcome Monitoring: Erfahrungen aus der Praxis
Das Routine Outcome Monitoring (ROM) bezeichnet eine regelmäßige, standardisierte Diagnostik und den Einbezug der Diagnostik-Ergebnisse in der Therapieplanung über den gesamten Therapieverlauf hinweg und wird seit November 2024 schrittweise in der Universitätsambulanz eingeführt. Die Nutzung des ROM kann dazu beitragen, ungünstige Therapieverläufe früher zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Therapieerfolgs einzusetzen. Insbesondere Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko für ungünstige Therapieverläufe können vom ROM besonders profitieren.
Die Universitätsambulanz untersucht in einer qualitativen Studie, wie das ROM von Patientinnen und Patienten und von Therapeutinnen und Therapeuten wahrgenommen wird. Dazu werden Interviews mit Patientinnen und Patienten und mit Therapeutinnen und Therapeuten, die das ROM in ihren Therapien nutzen, geführt. Die Interviews erfassen, welche Auswirkungen des ROM auf den Therapieverlauf von den Nutzenden beobachtet werden, in welcher Form die Ergebnisse des ROM in die Therapieplanung einbezogen werden und welche möglichen Belastungen oder Schwierigkeiten mit dem Einsatz des ROM einhergehen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den von Nutzenden erlebten Auswirkungen des ROM auf die therapeutische Beziehung. Die Interviews werden zunächst transkribiert und anonymisiert und dann qualitativ ausgewertet.
Ansprechpartnerin: Franziska Epe-Jungeblodt, franziska.epe@uni-wuerzburg.de